Zum Start des Wintersemesters tauchten unsere erstsemestrigen Masterstudierenden in eine intensive Workshop-Woche ein: Gemeinsam mit dem Building Innovation Cluster Oberösterreich und fünf Unternehmenspartnern entwickelten sie zirkuläre Geschäftsmodelle, die nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften mit unternehmerischer Realität und Rentabilität vereinen sollte – eine höchst spannende Herausforderung wie sich zeigte.
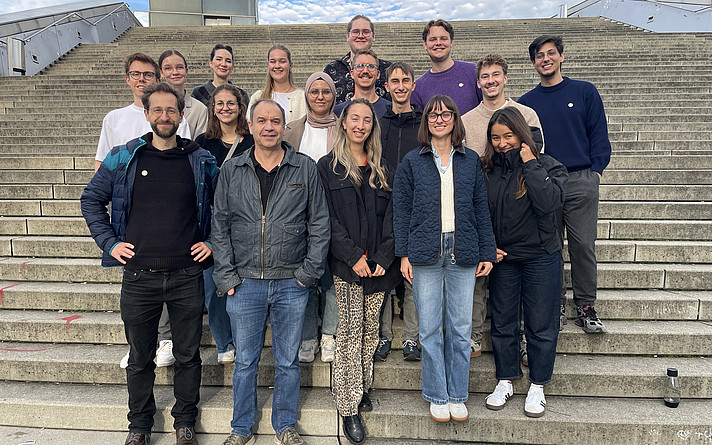
Hintergrund ist der Wandel von der linearen zur zirkulären Wirtschaft, die weniger rohstoffintensiv ist, Materialien möglichst lange in der Nutzung hält und geschlossene Materialkreisläufe ohne Abfall ermöglicht. Auf diese Weise soll der enorme Material-Fußabdruck von derzeit 33 Tonnen pro Jahr und Person auf 7 Tonnen im Jahr 2050 gesenkt werden. Für dieses ambitionierte Unterfangen sind laut nationaler Kreislaufwirtschaftsstrategie nicht nur verbessertes Produktdesign und effizientere Produktionsweisen nötig, sondern völlig neue Denkweisen, was die Geschäftsmodelle von Unternehmen angeht.
Teil der New European Bauhaus Initiative
Die Workshopwoche verband die beiden Vorlesungen von Dominik Walcher (Zirkuläre Wertschöpfung) und Markus Petruch (Circular Economy), in denen die Studierenden die Grundlagen einer zirkulären Wirtschaftsweise und über 20 verschiedene Geschäftsmodelle der Circular Economy kennenlernten, um lineare Wertschöpfung in Kreisläufe zu überführen. Integriert wurden die Vorlesungen in das europäische Forschungsprojekt DECORATOR des Building Innovation Clusters Linz, welches mit Partnerinstitutionen in ganz Europa im Rahmen des New European Bauhaus (NEB) nachhaltige Lösungen für Architektur und Bauwirtschaft entwickelt. Das NEB wiederum ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die den Green Deal mit den Werten Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklusion verbindet, um eine gebaute Umwelt zu schaffen, die lebenswert, schön und gerecht für alle ist.
Von Tiny Houses und geschlossenen Materialkreisläufen
Die Unternehmenspartner brachten im Vorfeld reale Fragestellungen ein, mit denen sich die Studierenden übers Wochenende in einer Recherchephase vertraut machen – etwa zur regionalen Wertschöpfung, zur Wiederverwendung von Baustoffen oder zu innovativen Produktideen. Anschließend entwickelten sie darauf basierende Geschäftsmodelle zum Bau und Betrieb von Tiny Häusern aus regionalen Materialien (hubfour Architecture), zu einem sozial-integrativen Revitalisierungsprojekt auf dem Gelände einer ehemaligen Tischlerei (Unsere Tischlerei), Konzepte zum Betreiben von Mobilitätsstationen für regenerative Energie (Innovametall), wirtschaftlich Möglichkeiten der Betonteil-Wiederverwendung in der Architektur und Geschäftsmodelle für die zirkuläre Nutzung von Lehmbauplatten (Naturbo). Nach kurzen Pitches vor der gesamten Gruppe wurden die Konzepte mit den Unternehmensvertretern anschließend einzeln vertieft und weiterentwickelt – im ständigen Wechselspiel zwischen studentischer Kreativität und gelebter Unternehmensrealität. Die abschließende Diskussion zeigte, dass beide Seiten sich einiges für die Zukunft mitnehmen konnten, entweder neues Wissen in Sachen der nachhaltigen Wertschöpfung, oder als Einblick in die Herausforderungen, die es bei der Transformation zu echtem Kreislaufwirtschaften zu meistern gilt.
Starke Basis für die nächsten Semester
Die arbeitsreiche Woche legte eine fundierte Basis in Sachen Circular Economy und Geschäftsmodellentwicklung für die kommenden Semester. Viele Teams und Unternehmen wollen auch über das Projektende hinaus in Kontakt bleiben, um die entwickelten Konzepte und Designs weiterzuführen oder gar in Semesterprojekte, Praktika oder der Masterarbeit einfließen zu lassen.
Zum Abschluss bot der Besuch des Ars Electronica Center Linz Inspiration zu Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz im Design, additiver Fertigung und biobasierter Materialentwicklung – allesamt Themen, die sich mit Lehre und Forschung am Departments Design and Green Engineering in Kuchl überschneiden.












